|
Die
Reichweite des Saarbrücker Wartburg-Senders endete
wegen seiner
geringen Leistung und der Behelfsantenne schon in
der näheren Umgebung
der Hauptstadt. Aber er war der erste
Mittelwellensender der
französischen Zone; die Station in Baden-Baden
sendete damals noch auf
Kurzwelle.
Als am 31. März 1946 der Südwestfunk
in
Baden-Baden entstand,
wurde Radio Saarbrücken diesem zunächst
untergeordnet und damit zu
einem Regionalsender des SWF. Er strahlte -
genauso wie z.B. Radio
Koblenz - außerhalb eines täglichen
anderthalbstündigen regionalen
Fensters das für die ganze französische Zone
bestimmte
Südwestfunk-Programm aus. Dieser Zustand dauerte
aber nur einige
Monate.
Nach
Klärung der Besitzfrage des Geländes in Heusweiler
konnte die
Sendeanlage von Radio Saarbrücken am 19. Juni 1946
wieder nach dort
verlegt werden. Sie verfügte nun über einen
2-kW-Sender, der zunächst
eine zwischen zwei 30 Meter hohen Masten aufgehängte
T-Antenne speiste.
Kurze Zeit später errichtete man einen 50 m hohen
selbststrahlenden
Stahlgittermast. Damit konnte der Sender bereits in
weiten Teilen des
Saarlandes empfangen
werden.
Als
die Militärregierung damit begann, unser Land
von der übrigen
französischen Besatzungszone abzutrennen, beschloss
man in Baden-Baden
am 24. Juni 1946, ein saarländisches Rundfunkamt
einzurichten. Dessen "Contrôleur Général" wurde
Emanuel Charrin. Am 15. September 1946 wurde
Radio Saarbrücken wieder vom SWF-Sendernetz
abgekoppelt und setzte sein eigenständiges Programm fort. Nur noch wenige Sendungen am Tag übernahm er weiterhin
vom Südwestfunk.
Am 16.
November 1947 wurde das Rundfunkamt in "Saarländische
Rundfunkverwaltung" umbenannt und die Oberaufsicht
auf Gilbert Grandval übertragen, der
alsbald einen neuen Verwaltungsrat für
Radio Saarbrücken einsetzte. Da die
Führungspositionen des Senders 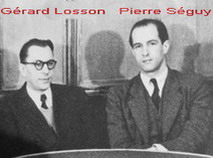 weiterhin von
Franzosen besetzt sein mussten, wurde
der
Pariser
Brunschwig
zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt, sein
Stellvertreter wurde
Erwin Müller. Gilbert Grandval hatte das Recht auf
ein Veto gegen alle
Entscheidungen. Kurz danach wurde Gérard
Losson erster Generaldirektor von Radio
Saarbrücken und damit Nachfolger Charrins.
Sendeleiter war (bis 1951) Pierre Séguy.
Bis zum Erlass des ersten saarländischen
Rundfunkgesetzes im Jahr 1952 übte Frankreich die Funkhoheit im
Saarland aus und konnte so auch die Programminhalte
des Senders beeinflussen. weiterhin von
Franzosen besetzt sein mussten, wurde
der
Pariser
Brunschwig
zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt, sein
Stellvertreter wurde
Erwin Müller. Gilbert Grandval hatte das Recht auf
ein Veto gegen alle
Entscheidungen. Kurz danach wurde Gérard
Losson erster Generaldirektor von Radio
Saarbrücken und damit Nachfolger Charrins.
Sendeleiter war (bis 1951) Pierre Séguy.
Bis zum Erlass des ersten saarländischen
Rundfunkgesetzes im Jahr 1952 übte Frankreich die Funkhoheit im
Saarland aus und konnte so auch die Programminhalte
des Senders beeinflussen.
Nach der Verabschiedung
der saarländischen Verfassung Ende 1947 nahm das
Programm aber allmählich immer mehr saarländische
Züge an. Die Regierung des Saarlandes konnte
von 1948 an nach und nach einen gewissen
Einfluss auf das Programm der Station ausüben. Ab 1949 begann
und endete die tägliche Ausstrahlung mit der Saarhymne. Der Verwaltungsrat setzte sich jetzt zu
gleichen Teilen aus französischen und
saarländischen Vertretern zusammen. Unter ihnen waren Erwin Müller, Johannes
Kirschweng und Albert Dorscheid.
Der
Vorsitzende musste aber weiterhin ein Franzose sein.
Gérard Losson wurde
am 28. Oktober 1948 von dem im Elsass
geborenen Frédéric Billmann als
Generaldirektor abgelöst. Dieser
war um 1935 Leiter des Nachrichtendienstes beim
Sender Strasbourg
gewesen. So blieb die enge Verbindung zu
Frankreich ein beständiges
Element des Programms von Radio Saarbrücken. Man
brachte z.B.
Nachrichten aus Frankreich, und die Saarländer
durften an jedem Werktag
einen viertelstündigen Sprachkurs genießen ("Wir
lernen Französisch")
und konnten in einer Sendung mit dem Titel "So
lebt Frankreich" die
Lebensart
der Franzosen
kennen lernen.
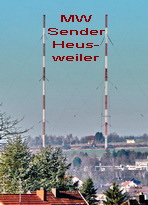 Im Juli 1948 stellte die Radio Diffusion
Française in Nancy Radio Saarbrücken einen 20-kW-Sender
von Thomson-Houston
leihweise
zur
Verfügung. Nachdem er am 14. Juli 1948
(französischer
Nationalfeiertag!) an einem neuen, 120 m hohen
Sendemast in Heusweiler in Betrieb
genommen wurde (mehr dazu auf unserer Seite
über den Mittelwellensender
Heusweiler!), erstreckte sich
die Reichweite tagsüber auf fast das gesamte
Saarland; nachts betrug sie sogar bis zu 500 km.
Auch die Sendefrequenz wurde geändert. Auf der Kopenhagener
Wellenkonferenz von 1948 wurde Radio Saarbrücken nun die Frequenz
1421 kHz = 211 Meter zugewiesen, die ab
September 1949 benutzt wurde (andere Quellen
nennen den 15. März 1950). Im Juli 1948 stellte die Radio Diffusion
Française in Nancy Radio Saarbrücken einen 20-kW-Sender
von Thomson-Houston
leihweise
zur
Verfügung. Nachdem er am 14. Juli 1948
(französischer
Nationalfeiertag!) an einem neuen, 120 m hohen
Sendemast in Heusweiler in Betrieb
genommen wurde (mehr dazu auf unserer Seite
über den Mittelwellensender
Heusweiler!), erstreckte sich
die Reichweite tagsüber auf fast das gesamte
Saarland; nachts betrug sie sogar bis zu 500 km.
Auch die Sendefrequenz wurde geändert. Auf der Kopenhagener
Wellenkonferenz von 1948 wurde Radio Saarbrücken nun die Frequenz
1421 kHz = 211 Meter zugewiesen, die ab
September 1949 benutzt wurde (andere Quellen
nennen den 15. März 1950).
Vom
August 1948 an wurden erstmals Werbesendungen im
Saar-Radio ausgestrahlt (siehe im Abschnitt "Radioreklame"
auf der Seite Radio Saarbrücken).
Schwarzenbergturm
Saarbrücken:
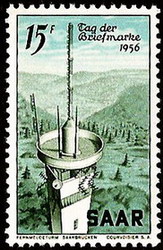 Am 28.7.1950 fand im
Großen Saal der Wartburg eine Bach-Gedenkfeier
statt. In seiner Einladung an den
Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann und dessen
Gattin wies Generaldirektor Billmann darauf hin,
dass dies das erste Konzert des Saar-Senders
sei, das vom französischen Rundfunk übernommen
werde. Am 28.7.1950 fand im
Großen Saal der Wartburg eine Bach-Gedenkfeier
statt. In seiner Einladung an den
Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann und dessen
Gattin wies Generaldirektor Billmann darauf hin,
dass dies das erste Konzert des Saar-Senders
sei, das vom französischen Rundfunk übernommen
werde.
Am
18. Juni 1952 wurde das erste
saarländische Rundfunkgesetz erlassen, und am
24. Oktober 1952 wandelte man die 1946/47
gegründete Saarländische Rundfunkverwaltung in "Saarländischer
Rundfunk GmbH"
um. Gesellschafter waren zu zwei Dritteln die
Regierung des Saarlandes und zu einem Drittel die Société
Financière de Radiodiffusion (SOFIRAD) in
Paris, die sich im Aktienbesitz des französischen
Staates befand.
Obwohl die Rundfunkhoheit nun offiziell auf das
Saarland überging,
blieb der Einfluss der Franzosen durch ihre
finanzielle Beteiligung und
durch die Präsenz der vier französischen Mitglieder
im Rundfunkrat
weiterhin gewährleistet. Außerdem war der bisherige französische Generaldirektor
Billmann nach wie vor im Amt. Aber
es
wurde jetzt ein saarländischer Geschäftsführer eingesetzt,
dessen Funktion etwa der des späteren Intendanten
entsprach. Dabei kam zunächst Hans Wettmann
zum Zuge.
 Das
Radioprogramm lief weiterhin unter dem Stationsnamen
"Radio Saarbrücken". Im Mai 1952 nahm der erste
UKW-Sender
im Land seinen Betrieb auf. Er hatte eine
Strahlungsleistung von 1,5 kW und befand sich auf dem Schwarzenbergturm in Saarbrücken (siehe
Bild auf der Briefmarke oben und Foto rechts). Er
strahlte zunächst dasselbe Programm wie auf
Mittelwelle aus. 1953 startete, zunächst für
wenige Stunden am Tag [1], das neue 2.
Programm.
Während der übrigen Zeit wurde weiterhin das
Mittelwellenprogramm
ausgestrahlt. Mit Hilfe der auf UKW verwendeten
Frequenzmodulation (FM)
wurde eine wesentlich bessere Tonqualität erreicht
("Hi-Fi"). Die
Ausstrahlung von Stereo-Sendungen begann im
Saarland wie in der übrigen
BRD allerdings erst 1963. Das
Radioprogramm lief weiterhin unter dem Stationsnamen
"Radio Saarbrücken". Im Mai 1952 nahm der erste
UKW-Sender
im Land seinen Betrieb auf. Er hatte eine
Strahlungsleistung von 1,5 kW und befand sich auf dem Schwarzenbergturm in Saarbrücken (siehe
Bild auf der Briefmarke oben und Foto rechts). Er
strahlte zunächst dasselbe Programm wie auf
Mittelwelle aus. 1953 startete, zunächst für
wenige Stunden am Tag [1], das neue 2.
Programm.
Während der übrigen Zeit wurde weiterhin das
Mittelwellenprogramm
ausgestrahlt. Mit Hilfe der auf UKW verwendeten
Frequenzmodulation (FM)
wurde eine wesentlich bessere Tonqualität erreicht
("Hi-Fi"). Die
Ausstrahlung von Stereo-Sendungen begann im
Saarland wie in der übrigen
BRD allerdings erst 1963.
Radio
Saarbrücken war schon in den frühen 50er-Jahren
"ein
bestens ausgestattetes Unternehmen mit fünf
vollständig
ausgerüsteten Studios, Zehntausenden von
Schallplatten und Bändern und
über 200 fest angestellten Mitarbeitern." [2] Da im Funkhaus
Wartburg der Platz eng wurde, mietete man 1953
zusätzliche
Räume im Städtischen Saalbau am Kleinen Markt in
Saarlouis an. Dessen großen Saal nutzte
auch das Saarländische Kammerorchester als Probe-
und Aufnahmeraum. Diese "Dépendance" wurde unter der
Bezeichnung "Studio Saarlouis" bekannt.
In
der Bundesrepublik und in Frankreich hatte sich nach
dem Kriegsende das
System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
durchgesetzt. Kommerzielle
Radio- und Fernsehsender waren dort nicht zulässig.
Im neuen
saarländischen Rundfunkgesetz von 1952 wurde dagegen
festgelegt, dass
in- oder ausländische Gesellschaften
eine Konzession zum Errichten und/oder Betreiben von
Radio- und
Fernsehsendern im Saarland erhalten konnten. Damit
wurde der Grundstein
gelegt für die Schaffung privater Rundfunkstationen.
So konnten
französische Investoren Ende 1954 zunächst
probeweise und am 1. Januar 1955 dauerhaft den
Langwellen-Werbesender Europe No. 1
auf saarländischem Grund und Boden auf dem Sauberg
bei Felsberg-Berus
in Betrieb nehmen und betreiben. Und schon Ende 1953
begannen im
Saarland reguläre kommerzielle Fernsehsendungen
unter dem Stationsnamen
Telesaar in deutscher Sprache, veranstaltet
von der im Mai 1952 gegründeten Saarländischen
Fernseh AG. Deren Hauptaktionär war die
private französisch-monegassische
Holdinggesellschaft Images et Son.
(Alle
Einzelheiten hierzu finden Sie auf unseren Seiten
Europe No. 1
und Telesaar.)
---------------------------
[1]
z.B. im März 1955 täglich von 18:05 bis 22:15 Uhr,
sonntags zusätzlich
von 8.15 bis 12 Uhr. (Medienlandschaft Saar, Bd. 3,
S. 20f).
[2] Website des SR:
www.sr-online.de; aufgerufen 2010.
Ab
1953: Große Pläne für den Ausbau von Radio und
Fernsehen (die aber so nicht ausgeführt wurden)
Von
1953 an plante man im Bereich Rundfunk und Fernsehen
mehrere weitere
große Projekte im Saarland. Auf einer
Pressekonferenz gab der
Generaldirektor der "Saarländischer Rundfunk GmbH",
Frédéric Billmann (siehe Foto),
Anfang Juli 1954 folgenden Überblick über
die damals auf dem Felsberg bei Berus geplanten
Einrichtungen
(die meisten davon wurden aber wegen der unsicheren
politischen Lage vor und der grundlegenden
Veränderungen nach der Volksbefragung
im Oktober 1955 nicht
verwirklicht
- siehe weiter unten!)
Die im
Folgenden in
brauner Farbe wiedergegebenen
Zitate entstammen einem Zeitungsbericht aus
der SVZ vom 3. Juli 1954 mit der
Überschrift "Neubauten
des Saarbrücker
Rundfunks"; [in eckigen Klammern stehen dazwischen
in schwarzer Farbe unsere eigenen Kommentare
dazu]:

"Dort
wird
eine ganz neue moderne Anlage erbaut, die den
gesamten
Bedürfnissen an Sendeanlagen des Rundfunks und des
Fernsehens
entspricht. Es entstehen in nächster Zeit auf dem
Felsberg:
1.
Ein neuer Mittelwellensender, der die
Heusweiler Anlage ersetzen und dem sich der
Heusweiler Sender zugesellen wird. Insgesamt stehen demnächst 120 kW
zur Verfügung ..." [Mit
dieser
etwas unklaren Aussage
wollte Billmann wohl sagen, dass dieser neue
Sender - zusätzlich zu dem
20 kW starken Heusweiler Sender - das Programm von
Radio Saarbrücken
von Berus aus mit 100 kW auf MW verbreiten sollte.
Ein MW-Sender in
Berus wurde aber nie realisiert, und erst
1958 erfuhr der Heusweiler Sender eine
Leistungserhöhung von 20 auf 100 kW.]
"...
2. ein UKW-Sender, weil der Sender
auf dem Schwarzenberg nicht ausreicht, um das ganze
Saarland zu bestreichen ..." [Der neue stärkere UKW-Sender wurde
aber nicht, wie hier angekündigt, in Felsberg
errichtet, sondern 1956 mit 10 KW Strahlungsleistung auf dem Schaumberg bei Tholey.]
"...
3. kommt auf dem Felsberg der neue große
Fernsehsender Saarbrücken..." [er sollte zusätzlich zu
dem schon bestehenden "heimatlichen" TV-Sender Telesaar ein neues
so genanntes "europäisches" Fernsehprogramm von
Berus aus unter dem Namen "Europe No. 1 -
Télévision"
abstrahlen.
Dieses kam aber nie zustande
(mehr zum Fernsehen im Saarland siehe auf
unserer Seite Telesaar).]
"...
sowie 4. ein auf europäische Maße
berechneter Reklamesender"... [damit war
der schon weiter oben erwähnte LW-Großsender Europe No. 1 gemeint, der Ende 1954 auf
Sendung ging und dort noch heute in Betrieb ist -
siehe hier ganz unten im Abschnitt 5) und auf unserer Seite Europe
No.1!]
"...
und für später ist noch ein Kurzwellensender
in Aussicht genommen."
[ein solcher
Sender wurde aber nie gebaut.]
Darüber
hinaus soll Billmann auf dieser Pressekonferenz
bekannt gegeben haben, dass dem Saarländischen
Rundfunk (er wird in dem Zeitungsbericht noch
nicht als "SR", sondern als "SRF" abgekürzt!)
auf dem Saarbrücker Winterberg ein sechs
Hektar großes Areal aus städtischem Besitz
überlassen worden sei. Dort sollte
er in den folgenden Jahren seine Neubauten
errichten. Dabei war nicht an einen "klotzigen
Betonbau"
gedacht, sondern an "vier
Häuser in parkartigem Gelände". Zur Planung solle ein
"Ideenwettbewerb unter den saarländischen und
europäischen Architekten" ausgeschrieben werden.
|
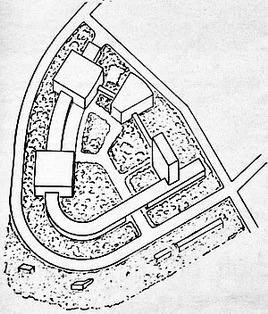
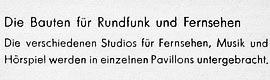
|
100.000
cbm umbauten Raumes sollten bis zum
31.12.1956 auf dem Winterberg entstehen.
Danach sollte der "SRF
aus dem jetzigen provisorischen Funkhaus
in der
Wartburg aus-scheiden", weil der Vertrag mit
dem Besitzer an diesem Tag ablief.
Auch
die Studios des damals noch geplanten (aber
dann doch nicht
verwirklichten) europäischen Fernseh-
senders "Europe No. 1 Télévision"
(siehe
oben unter 3. und auf unserer Seite Europe No. 1) sollten
auf dem Winter-
berg
eingerichtet werden.
|
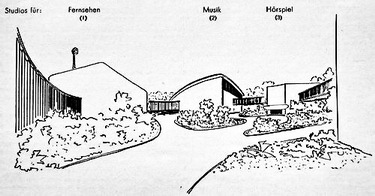
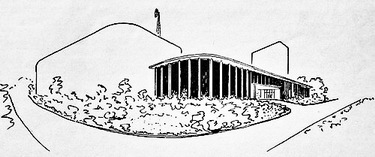
|
Es kam
aber alles anders: Diese
Pläne von 1953/55 wurden auf Grund des Ergebnisses
der Volksbefragung
vom 23. Oktober 1955 über das Saarstatut nicht
umgesetzt. Radio Saarbrücken blieb vorläufig
weiterhin in der Wartburg, und der kommerzielle
Fernsehsender Telesaar
produzierte in seinen Studios in der Saarbrücker
Richard-Wagner-Straße
nach wie vor die Programme, die bis zu seinem Ende
im Jahr 1958 vom
Eschberg-Sender ausgestrahlt wurden. Die geplante
neue Fernsehstation "Europe No. 1 Télévision"
wurde nicht verwirklicht (siehe
dazu auch auch unsere Seite
Europe No.1"!).
Auf
dem Winterberg ist Jahre später (1968) ein ganz
anderer, viel größerer
Gebäudekomplex errichtet: das Winterbergkrankenhaus.
Noch später kam
auch das Fernsehen dort an, aber nicht mit Studios,
wie in der 50ern
geplant, sondern nur in Form einer Senderanlage mit
einem 100 Meter
hohen Stahlbetonturm, von dem aus verschiedene
Fernseh-und
Rundfunkprogramme mit einer niedrigen Sendeleistung
und geringer
Reichweite in den Saarbrücker Raum abgestrahlt
wurden.
---------------------------
Die
Zeichnungen oben wurden 1953 veröffentlicht in:
Saarbrücken -
Sarrebruck. Sitz der Montanunion - Siège du Pool
Carbonnier
Charbon-Acier. Bau-Anzeiger für das Saarland Nr.
8/9. Sonderausgabe zur
Saar-Messe 1953. Saarbrücken, 24. April 1953.
Seite 27.
|

|
Die
Entwicklung nach der Volksbefragung
vom 23. Oktober 1955 zum Saarstatut
Anfang
1955 hatte Prof. Hermann M. Görgen den
bisherigen Geschäftsführer der
"Saarländischer Rundfunk GmbH", Hans
Wettmann, abgelöst.
Aber
unmittelbar
nach dem Referendum wurde Görgen von der
Übergangsregierung
Welsch seines Amtes enthoben. Neuer
Geschäftsführer wurde Prof. Dr. Eugen
Meyer. Als Programmdirektor
stellte man Dr. Alexander
Schum ein. Chefredakteur war Wilhelm
Diederich.
|
|
Lesen
Sie bitte hier
im Abschnitt 17b auf der
Seite Radio Saarbrücken Infos
über die Rolle des Senders bei der
Volksbefragung 1955.
Nach
der Volksbefragung änderte sich das Programm von
Radio Saarbrücken von heute auf morgen -
aber nur in wenigen Teilen: Die
Ausrichtung der Nachrichten- und
Zeitfunksendungen (z.B. die "Stimme des Tages") und
anderer Programme
wurde nun
auf die neue Lage
eingestellt. Es entfiel z. B. vom ersten
Sonntag nach der Abstimmung an
plötzlich und ohne Ankündigung die bisher
überaus beliebte
allsonntägliche "Saarlandbrille" (siehe
unsere Extra-Seite dazu!). Der
Grund dafür lag wohl darin, dass in dieser
kabarettistischen Sendung
häufig auch politisiert worden war, und
zwar natürlich meist
regimetreu. Die Ablehnung des Saarstatuts
zeigte aber nun, dass sich
die politische Stimmung im Land
offensichtlich grundlegend geändert
hatte. Hierauf antworteten die beliebten
Figuren Zick, Zack und
Marieche... mit Schweigen. Von ihren drei
Sprechern blieb nur Fritz
Weissenbach
(noch für viele Jahre, meist zusammen mit
seiner Ehefrau Gerdi
zusammen) weiterhin auf anderen
Programmplätzen präsent.
(Hören Sie >hier die komplette letzte Sendung
der
Saarlandbrille; sie kam am Mittag des
Abstimmungstages, dem 23. Oktober 1955, also wenige Stunden vor
der Bekanntgabe der Ergebnisse des
Referendums.)
Die
meisten anderen Sendungen blieben jedoch
weiter im Programm, wie "Der Bunte Teller" mit
Heinz Dützmann, "Allerhand
für Stadt und Land" mit den
Weissenbachs, die Hörspiele u.v.a. mehr.
|
|
C) Ab 1957: Saarländischer
Rundfunk, 1. und 2. Programm
|

|
Durch ein
neues Rundfunkgesetz vom 27. November 1956 wurde die bisherige "Saarländischer
Rundfunk GmbH" am
1. Januar 1957, dem Tag der politischen Eingliederung des Saarlandes in
die Bundesrepublik, in eine
"gemeinnützige
Anstalt des öffentlichen Rechts" umgewandelt.
Damit war sie nun
wie alle anderen bundesdeutschen Sender vom Staat
unabhängig. Der
Name "Radio Saarbrücken" wurde aufgegeben, und die
Programmnamen lauteten nun Saarländischer
Rundfunk, 1. und 2. Programm.
Es wurde ein
Rundfunkrat ins Leben gerufen, der im Juni 1957 Dr.
Franz Mai zum ersten Intendanten des SR
wählte. Er nahm am
1.1.1958 sein Amt auf.
In
einer leidenschaftlichen Pressekonferenz nahm er
Stellung zu der
inzwischen aufgekommenen Diskussion, ob das neue
kleine Bundesland
überhaupt eine eigene Rundfunkanstalt benötige und
ob es nicht
ausreiche, ein Landesstudio des Südwestfunks zu
gründen. Mai sagte, der
SR könne wie kein anderer deutscher Sender die
Aufgabe lösen, aus
seiner Kenntnis der französischen Mentalität heraus
die geistige Begegnung Deutschlands und Frankreichs
fruchtbar zu
machen. Auf die Frage, wie ein solcher Sender
finanziert werden sollte,
antwortete er, er habe noch keine konkrete Lösung
parat, aber es
führten ja "viele Wege nach Rom".
 In der Tat war die finanzielle
Situation des SR sehr schwierig. Seine Einnahmen
durch die
Rundfunkgebühren waren aufgrund der geringen
Bevölkerungszahl des
Landes recht bescheiden und reichten knapp für den
laufenden
Sendebetrieb.
Die Intendanten der Arbeitsgemeinschaft
der Rundfunkanstalten Deutschlands (ARD) wollten der
saarländischen
Bevölkerung wohl aus Respekt für deren kurz zuvor
getroffene Entscheidung zum Anschluss an die Bundesrepublik
dabei
helfen, ihren eigenen Sender im Land zu erhalten.
Deshalb
beschlossen sie auf ihrer Konferenz vom 8. November
1957 in Frankfurt,
den SR nach dem Ende einer Aufbauphase in die ARD
aufzunehmen. Schon
Ende 1958
genehmigten sie dem SR einen Finanzausgleich, der
dessen Existenz
langfristig sichern sollte. Der vollständige
Anschluss an die ARD
erfolgte am 1. Mai 1959. In der Tat war die finanzielle
Situation des SR sehr schwierig. Seine Einnahmen
durch die
Rundfunkgebühren waren aufgrund der geringen
Bevölkerungszahl des
Landes recht bescheiden und reichten knapp für den
laufenden
Sendebetrieb.
Die Intendanten der Arbeitsgemeinschaft
der Rundfunkanstalten Deutschlands (ARD) wollten der
saarländischen
Bevölkerung wohl aus Respekt für deren kurz zuvor
getroffene Entscheidung zum Anschluss an die Bundesrepublik
dabei
helfen, ihren eigenen Sender im Land zu erhalten.
Deshalb
beschlossen sie auf ihrer Konferenz vom 8. November
1957 in Frankfurt,
den SR nach dem Ende einer Aufbauphase in die ARD
aufzunehmen. Schon
Ende 1958
genehmigten sie dem SR einen Finanzausgleich, der
dessen Existenz
langfristig sichern sollte. Der vollständige
Anschluss an die ARD
erfolgte am 1. Mai 1959.
Die Wartburg
erwies
sich als immer weniger geeignet für den Betrieb als
Funkhaus. Sie war z.B. nicht genügend schalldicht.
Man
hatte
zwar Vorkehrungen getroffen, um dem
entgegenzuwirken, aber
trotzdem konnte man bei manchen Produktionen (z.B.
Horspiele) manchmal
die in der ein Mitarbeiter ber
1958 und 1959
wurde das neue Funkhaus nicht wie 1954 geplant auf
dem Winterberg, sondern auf dem Halberg gebaut,
und der Saarländische Rundfunk zog am 4. September 1961
dort ein. (Mehr darüber auf der Seite Wartburg).
Die
Sendeleistung auf Mittelwelle wurde kontinuierlich
erhöht: 1958 auf 100
kW, im Dezember 1963 auf 300 und im Februar 1964 auf
400 kW. 1965 baute
man die bisherige Antenne mittels eines zweiten,
ebenfalls 120 Meter
hohen Mastes in eine 2-Element-Antenne um. Die
Reichweite des Senders
vergrößerte sich dadurch erheblich. Er konnte nun
nachts bereits in
weiten Teilen Europas empfangen werden. (Mehr
darüber auf unserer Extra-Seite über den
Sender Heusweiler.)
Im
folgenden Abschnitt 4) berichten wir aus Gründen
der Kontinuität über
die weitere Entwicklung des saarländischen
Rundfunkwesens nach 1960.
Obwohl diese Zeit außerhalb der eigentlichen
"Saar-Nostalgie-Periode"
(1945 - 59) liegt, meinen wir, dass sie für
unsere Leser ebenfalls von Interesse ist.
D)
Nach 1960: Europawelle (ab 1964), Studiowelle (ab 1967) und Saarlandwelle (ab 1980)
Bis
Ende 1963 lief das erste Programm des SR in
ähnlichen Bahnen weiter wie
bisher. Aber am 2. Januar 1964 krempelte der Sender
seinen
Programmablauf vollkommen um. Das bisherige
stringente Programmschema,
das auf der ziemlich strikten Trennung von Wort- und
Musiksendungen
basierte (siehe Seite Radio
Saarbrücken im Abschnitt 2b)
wurde aufgegeben. Die Moderatoren präsentierten
jetzt den ganzen Tag
über deutsche
und internationale Hits. In neu eingerichteten
"Selbstfahrerstudios"
legten sie bei vielen Sendungen immer öfter die
Schallplatten wie
Diskjockeys eigenhändig auf. Der Anteil an
kommerzieller Popmusik wurde
allmählich immer größer. Das Programm erhielt den
Namen Europawelle Saar (später SR1 -
Europawelle).
Die
Nachrichten kamen nun zu jeder vollen Stunde und
dauerten nur noch
höchstens fünf Minuten. Über brandaktuelle wichtige
Ereignisse wurden
zusätzlich Blitzmeldungen ins laufende Programm
eingestreut
("Europawelle Saar - Aktueller Dienst").
Ausführliche Berichte und
Kommentare verbreiteten die Zeitfunkmitarbeiter in
extra dafür
geschaffenen Magazinsendungen. Die erste von ihnen
hieß "Zwischen heute
und morgen". Sie wurde
von Axel Buchholz
moderiert
und 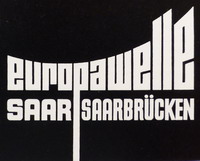 enthielt
zahlreiche Live-Interviews mit Politikern oder
anderen wichtigen
Gesprächspartnern über Telefon. Eine weitere Neuheit
- und für den
bundesdeutschen Rundfunk fast eine kleine Sensation
- war damals auch,
dass man die Werbung nicht mehr wie bisher (siehe
Seite Radio
Saarbrücken unter Radioreklame)
vom normalen Programm abtrennte und innerhalb
gesonderter Werbefunk-Sendungen ausstrahlte, sondern
stattdessen über den ganzen
Tag verteilte und in kurzen Blöcken mehrmals in der
Stunde ins
laufende Programm einstreute. enthielt
zahlreiche Live-Interviews mit Politikern oder
anderen wichtigen
Gesprächspartnern über Telefon. Eine weitere Neuheit
- und für den
bundesdeutschen Rundfunk fast eine kleine Sensation
- war damals auch,
dass man die Werbung nicht mehr wie bisher (siehe
Seite Radio
Saarbrücken unter Radioreklame)
vom normalen Programm abtrennte und innerhalb
gesonderter Werbefunk-Sendungen ausstrahlte, sondern
stattdessen über den ganzen
Tag verteilte und in kurzen Blöcken mehrmals in der
Stunde ins
laufende Programm einstreute.
Die
übrigen ARD-Anstalten protestierten zunächst heftig
dagegen und drohten
sogar mit dem Ausschluss des SR aus der ARD. Sie
warteten jedoch
zunächst ab und mussten bald erkennen, dass der SR
mit diesem
innovativen Konzept Riesenerfolge bei den Hörern
einheimste. Und
schließlich wendete sich das Blatt: Immer mehr
andere ARD-Sender ahmten
das neuartige Format der Europawelle in ihren
eigenen Programmen nach.
1972
wurde die Mittelwellen-Sendeleistung auf 600 kW
erhöht, ab 1973
tagsüber
sogar auf 1200 kW; nur nachts schaltete man auf 600
kW zurück. Aber
auch dies reichte aus, um bei Dunkelheit in ganz
Europa und sogar in
Nordadfrika empfangen zu werden. Auch hinter dem
Eisernen Vorhang wurde
die Europawelle bald zu einem überaus beliebten
Sender mit aktuellen
Informationen aus dem Westen und neuester
internationaler Musik. (Lesen Sie dazu bitte auch unseren
ausführlichen Bericht über die Entwicklung des Heusweiler Mittelwellensenders.)
Die
Namen der bekanntesten Moderatoren der
Europawelle Saar (nach Familiennamen alphabetisch
geordnet):
Martin
Arnhold, Christian Balser, Axel Buchholz, Holger
Büchner, Brita-Maria Carell, Carina Dewes, Wolfgang Dorn,
lona Christen-Kleitz (†
2009),
Wilken ("Willem") F. Dincklage (†
1994),
Wolfgang
Dorn, Colette
Dryja, Franz
Duhr (†
1977), Bernd
Duszynski (†
1999),
Heinz Dützmann (†
1977), Wilfried
Eckel, Jutta Eckler († 2005), Dieter Exter, Heike Greis, Wolfgang
Gretscher, Uwe
Groke († 2015), Klaus Groth (†
1980),
Paul Güth, Dieter Thomas Heck (†
2018),
Wolfgang Hellmann (†
2001), Roland Helm, Elke Herrmann (†
2009), Jan
Hofer, Frank Rainer Huck, Christian Job, Heinrich Kalbfuß (†
20XX); Volkmar
Lodholz, Peter Maronde (†
1991), Roland
Müller († 198x), Torsten Pietkewicz, Thomas Rosch, Eberhard
Schilling, Tommi Schminke, Pierre Séguy (†
2004),
Manfred Sexauer († 2014), Clay Sherman (†
1984),
Verena Sierra, Daniel Simarro, Enno Spielhagen
("Franz", †
1974),
Hermann Stümpert (†
2005),
Erich Werwie (†
1998), Alf
Wolf († 2012), Werner Zimmer (†
2015)
Die
Werbefunk-Sendung "Allerhand für Stadt und Land" mit
den Weissenbachs
(Fritz, †
1978 und
Gerti, †
1987) begann
1949 bei Radio Saarbrücken und lief auch auf der
Europawelle weiter bis 1976).
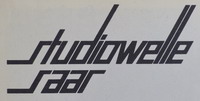 Als
Gegenpol zu der neuen "jungen" Europawelle, die die
große Masse der
Hörer seit 1964 in einer Art Dauerberieselung mit
Musik und
Informationen versorgte, baute der SR ab 1967 sein
Zweites Programm auf
UKW unter dem Namen SR 2 - Studiowelle Saar zu
einem
"Einschaltprogramm" um. Hier konnte der
anspruchsvolle Hörer klassische
Musik, Jazzkonzerte, Features aller Art oder
Hörspiele genießen. Beliebte Sendungen waren z.B.:
Morgengruß der
Studiowelle, Zwischen Saar und Mosel, Im Dreieck,
Glauben in dieser
Zeit (5-Min.-Andacht, lief zeitversetzt auch auf
SR1), Funkkolleg,
Jazzprisma, Hörspiele, Donnerstagsstudio Literatur,
sowie Frauen- und
Schulfunk u.v.m. Als
Gegenpol zu der neuen "jungen" Europawelle, die die
große Masse der
Hörer seit 1964 in einer Art Dauerberieselung mit
Musik und
Informationen versorgte, baute der SR ab 1967 sein
Zweites Programm auf
UKW unter dem Namen SR 2 - Studiowelle Saar zu
einem
"Einschaltprogramm" um. Hier konnte der
anspruchsvolle Hörer klassische
Musik, Jazzkonzerte, Features aller Art oder
Hörspiele genießen. Beliebte Sendungen waren z.B.:
Morgengruß der
Studiowelle, Zwischen Saar und Mosel, Im Dreieck,
Glauben in dieser
Zeit (5-Min.-Andacht, lief zeitversetzt auch auf
SR1), Funkkolleg,
Jazzprisma, Hörspiele, Donnerstagsstudio Literatur,
sowie Frauen- und
Schulfunk u.v.m.

Von 1964 an
gab es ein drittes Hörfunkprogramm des
SR auf UKW, das zunächst nur Gastarbeitersendungen
ausstrahlte und bald
auch andere Programminhalte verbreitete. Seit 1980
ist es unter dem
griffigen Namen SR 3 - Saarlandwelle zu
einem ebenfalls
erfolgreichen Vollprogramm nach dem Muster der
Europawelle geworden,
allerdings mit Ausrichtung auf eine etwas ältere
Hörer-Zielgruppe.
Die Amtszeit
des Intendanten Franz Mai endete
1978.
Nach ihm
folgten zunächst Dr. Hubert Rohde, 1989 Manfred
Buchwald, 1996 Fritz Raff und im Juli
2011 Prof. Thomas Kleist.
-------------------------
Alle
Signets dieser Seite: © Saarländischer
Rundfunk. Das Signet "SR
3" wurde von Wikipedia übernommen. Es trägt den
Vermerk "Gaspard
(selbst erstellt)"
|
Mehr
über RADIO SAARBRÜCKEN finden Sie
auf den Seiten Radio Saarbrücken
und Wartburg
mit
Informationen und Bildern über den
Sender, sein Programm, seine
Mitarbeiter und sein Funkhaus.
Alles
über den ersten saarländischen
Fernsehsender finden Sie auf der Seite
Telesaar.
|
E)
Privatfunk im Saarstaat: Der Langwellensender Europe
No
1
Dieser
private französische Rundfunksender strahlt sein
werbefinanziertes Programm seit 1955
(und noch heute als "Europe 1") über die weithin
sichtbaren
Langwellenantennen in Felsberg-Berus im Saarland
aus. Aufgrund seiner
starken Abstrahlleistung ist er in ganz Frankreich
empfangbar, nachts
sogar z.B. in Spanien, Italien und Nordafrika. Die
Antennenstrahlung
wird in Richtung Norden (Deutschland und Nordeuropa)
abgeschwächt. Die
saarländische Regierung erteilte dem
Betreiberkonsortium damals die
Sendelizenz für den privaten Rundfunksender auf
saarländischem Terrain.
Als Gegenleistung erhielt das Saarland den
deutschsprachigen
Fernsehsender Telesaar, der gleichzeitig die erste kommerzielle
TV-Station Europas darstellte.
Die
vollständige, hochinteressante Geschichte und
eine ausführliche
Beschreibung des privaten französischsprachigen
Radio- Werbesenders auf
saarländischem, ab 1957 bundesdeutschem
Staatsgebiet finden Sie auf
unserer Seite Europe
No
1.
F) Chronologische
Aufstellung
aller Ton-Rundfunksender
im Saarland
von
1935 bis in die heutige Zeit
|